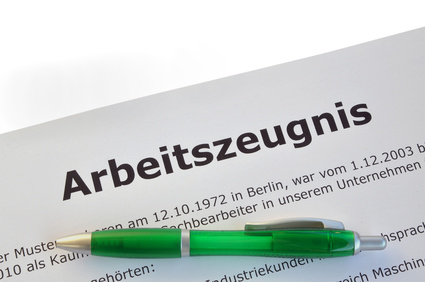Die Unterhaltsbeträge für Kinder werden zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung der Düsseldorfer Tabelle entnommen – diese wird in regelmäßigen Abständen den tatsächlichen Verhältnissen angepasst, zum letzten Mal ist dies zum 01.01.2015 geschehen. Bei der letzten Anpassung sind zwar die Unterhaltsbeträge für die Kinder nicht verändert worden, allerdings wurde der für den Unterhaltsschuldner wichtige Selbstbehalt erhöht und die für die höheren Einkommen zu Grunde zu legenden Bedarfskontrollbeträge wurden angepasst.
Die aktuelle Tabelle ergibt damit das folgende Bild:
| Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen Elternteils | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | Ab 18 | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis 1.500 € | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 880/1080 € |
| 1.501-1.900 € | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.180 € |
| 1.901-2.300 € | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.280 € |
| 2.301-2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.380 € |
| 2.701-3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.480 € |
| 3.101-3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.580 € |
| 3.501-3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.680 € |
| 3.901-4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.780 € |
| 4.301-4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.880 € |
| 4.701-5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.980 € |
| Über 5.101 | Nach Umständen des Falles OLG Düsseldorf Stand 01. Januar 2015 |
Die Düsseldorfer Tabelle regelt die Beträge, die ein Unterhaltsschuldner zahlen kann, wenn er zwei Berechtigten Unterhalt schuldet.
Die Erhöhung von Selbstbehalt und Bedarfskontrollbetrag bedeutet damit in der Praxis, dass viele Unterhaltsschuldner in eine niedrigere Einkommensgruppe eingeordnet werden können und entsprechend der Zahlbetrag angepasst werden kann.
Abänderbarkeit von Unterhaltszahlungen
Sofern die Beteiligten sich nur mündlich bzw. durch monatliche Zahlung auf einen bestimmten Unterhaltsbetrag verständigt hatten, ist eine Abänderung durch einfache Ankündigung und Anpassung des Zahlungsbetrags möglich.
Besteht jedoch ein Unterhaltstitel, ist eine Anpassung nur mit Zustimmung des anderen Elternteils möglich. Vorsorglich sollte die Zustimmung des anderen Elternteils zur Reduzierung des Unterhaltsbetrags schriftlich und unter teilweisem Verzicht auf den Unterhaltstitel erfolgen. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass aus dem weiterhin bestehenden Titel die nicht gezahlten Beträge zu einem späteren Zeitpunkt vollstreckt werden.
Ist eine Zustimmung des anderen Elternteils zur Abänderung des Unterhaltstitels nicht zu erreichen, kann die Abänderung durch gerichtliches Verfahren durchgesetzt werden.
Die Abänderung eines gerichtlichen Unterhaltstitels ist gemäß § 238 FamFG grundsätzlich immer dann möglich, wenn sich die der Entscheidung zu Grunde liegenden Verhältnisse wesentlich geändert haben. Als Wesentlichkeitsschwelle nimmt die Rechtsprechung hier eine Änderung des Unterhaltsbetrags von mindestens 10% an, wobei dieser Betrag in dem unteren Bereich der Tabelle und bei Erreichen des Existenzminimums nicht so streng gehandhabt wird. Bei Unterhaltstiteln, welche nicht auf gerichtlicher Entscheidung beruhen ergeben sich einige Besonderheiten, § 239 FamFG.
Aus der Sicht des Unterhaltsberechtigten liegt damit eine wesentliche Änderung der Verhältnisse regelmäßig bei Erreichen der nächsten Altersstufe vor. Aus der Sicht des Unterhaltsschuldners hingegen liegt sie regelmäßig bei Erreichen der Volljährigkeit des Kindes und Wegfall des Betreuungsunterhalts durch den anderen Elternteil sowie bei Beginn einer Ausbildung des unterhaltsberechtigten Kindes vor. Weiter besteht auch bei geänderten Einkommensverhältnissen beispielsweise durch längere Arbeitslosigkeit oder Renteneintritt die Möglichkeit einer Abänderung.
Im Falle der Änderung der Tabellensätze wird die Abänderung hingegen auf die Veränderung der tatsächlichen Lebensverhältnisse und die gesteigerten Lebenshaltungskosten gestützt, ein Überschreiten der 10%-Schwelle (wesentliche Änderung) wird nicht vorausgesetzt.
Eine Überprüfung der Unterhaltsbeträge ist daher in regelmäßigen Abständen sinnvoll und sollte insbesondere zu folgenden Zeitpunkten erfolgen:
– Das Kind erreicht die nächste Altersstufe
– Das Kind beginnt eine Ausbildung und erzielt Ausbildungsgehalt
– Das Kind wird volljährig
– Die Düsseldorfer Tabelle wird aktualisiert
– Das Einkommen des Unterhaltspflichtigen ändert sich.
Die Berechnung des Unterschiedsbetrags und die Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Abänderung erstellt Ihnen ein Fachanwalt/in für Familienrecht. Besteht für das Kind eine Beistandschaft bei dem Jugendamt, wenden Sie sich zur Überprüfung bitte an das Jugendamt.
Die gerichtliche Durchsetzung der Abänderung steht gemäß § 231 FamFG unter Anwaltszwang.
Ines Grille
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht